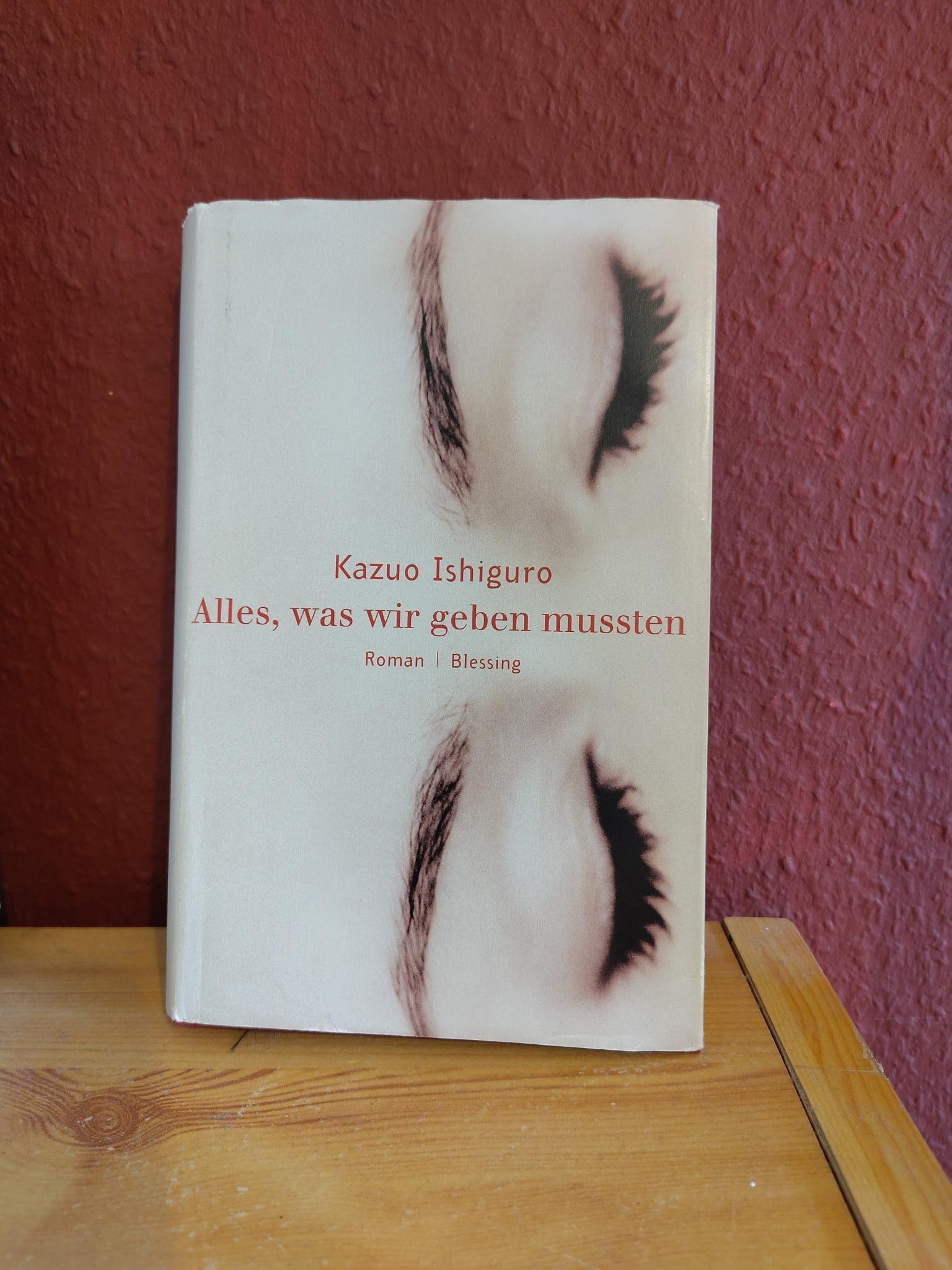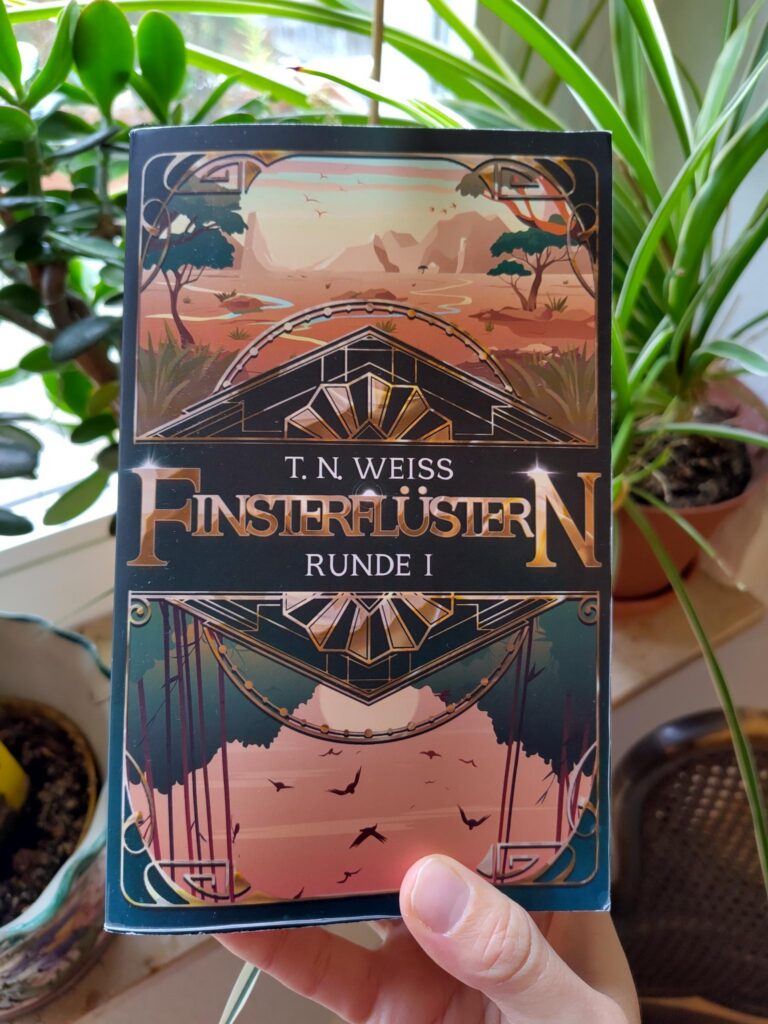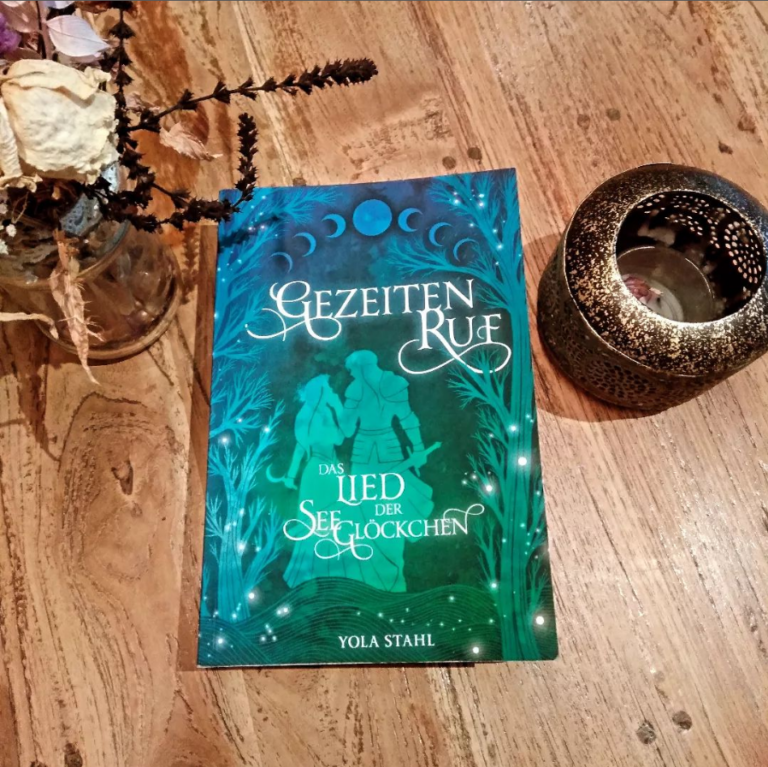In Großbritannien, Ende des 20. Jahrhunderts, werden Klone gezüchtet, um als Organersatzlager ausgeschlachtet zu werden. Der Roman begleitet das Aufwachsen dreier solcher Klone von ihrer Kindheit in einem Internat bis zum jungen Erwachsenenalter, wo sie mit dem „Spenden“ anfangen sollen.
Das klingt wie der Auftakt zu einem spannenden SF-Thriller. Typischerweise würde die brutale Ausbeutung der Klone in allen Farben gezeigt werden und die Klone würden gegen ihre grausamen Unterdrücker aufbegehren.
Nichts davon in diesem Buch.
Was das Buch stattdessen zeigt, ist das Mitmachen. Das stillschweigende Einverständnis. Dass Menschen diese Vorgänge so selbstverständlich finden, dass sie nicht einmal anfangen, etwas zu kritisieren.
Weder sind die Ärzte, Krankenpfleger oder die Erzieher der Kinder besonders grausam, sondern einfach nur Menschen, die ihren Job machen. (Auch wenn eine Erzieherin Probleme damit hat.) Noch rebellieren die Klone, sondern fügen sich in ihr Schicksal, erkennen es als ihre Bestimmung an. Gezeigt werden lauter gute Menschen, die nur Gutes wollen, und am Ende kommt die massenhafte Ermordung von Menschen dabei heraus, was euphemistisch als „Abschließen“ bezeichnet wird.
Als ich das Buch zum ersten Mal las, fand ich das schwer vorstellbar. Mittlerweile halte ich es für ein passendes Abbild der bürgerlichen Gesellschaft, wo auch niemand jemals etwas Böses will. Komischerweise gibt es dann eben Armut, Obdachlosigkeit oder den ein oder anderen Massenmord, für den scheinbar niemand verantwortlich ist.
Im Buch wird nie genauer erklärt, wie es zu dem Einverständnis kommt. Die Beteiligten halten einfach alle für richtig, was sie tun, und wollen ihren Beitrag zum Gemeinwesen leisten. Außerdem werden den Kindern im Heim Informationen bruchstückweise immer dann gefüttert, wenn sie noch zu jung sind, um sie wirklich zu verstehen.
Zu einer kleinen Rebellion kommt es dann aber doch, allerdings nur innerhalb des Systems. Unter den Klonen geht nämlich das Gerücht um, dass ein Junge und ein Mädchen einen Aufschub des Organspendens beantragen können, wenn sie einander wirklich lieben (das scheint nur für hetero Paare zu gelten).
Das Gerücht weckt bei Ruth, Kathy und Tommy die Hoffnung, den Versuch zu wagen. Unglücklicherweise sind die drei in ein Liebesdreieck verstrickt, sodass sie erst nach Sortieren ihrer Beziehungen diesen Weg gehen können. Scheinbar viel zu spät.
Dabei geht es viel um die zwischenmenschlichen Beobachtungen. Die Ich-Erzählerin Kathy beobachtet genau das Verhalten anderer, während sie über ihre eigenen Gefühle wenig sagt. Diese muss man zwischen den Zeilen lesen und sie treffen dafür umso heftiger.
Es geht auch um die Frage, ob man an Beziehungen wieder anknüpfen kann, die durch verletzende Worte zerbrochen wurden, oder ob es irgendwann zu spät dafür ist.
Die Sprache ist auf einem sehr hohen Niveau, lange Sätze, fast schon etwas altmodisch, was aber gut zur Stimmung passt.
Insgesamt ein Buch, das lange nachhallt.